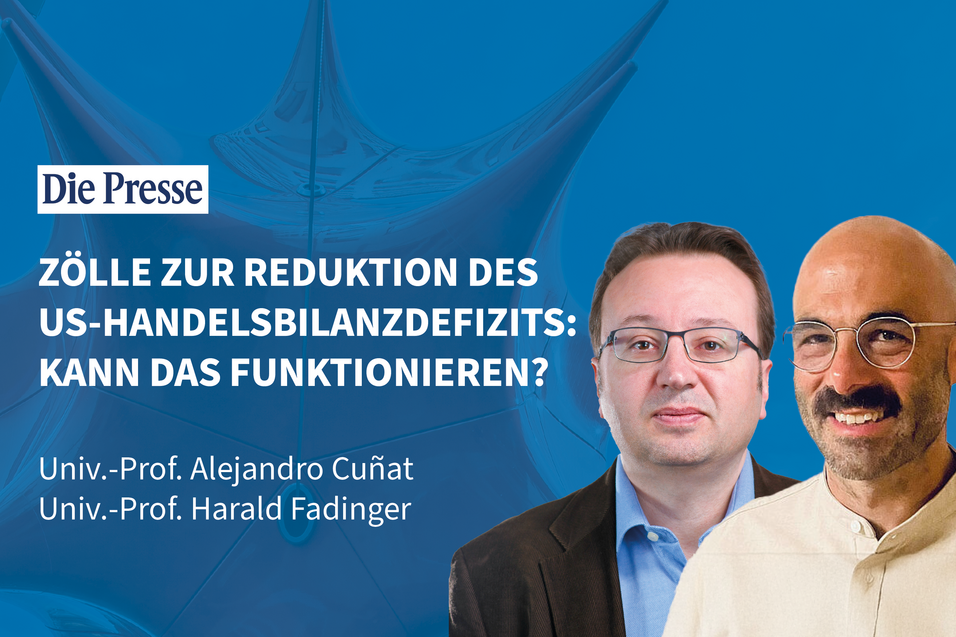In ihrem aktuellen Gastbeitrag in DiePresse analysieren Univ.- Prof. Alejandro Cunat und Univ.- Prof. Harald Fadinger die wirtschaftlichen Hintergründe von Donald Trumps Zollpolitik und zeigen auf, warum bilaterale Handelsdefizite kein sinnvolles Kriterium für Strafzölle sind.
Trumps Zollmaßnahmen fußen auf der Annahme vermeintlich unfairer Handelspraktiken. Grundlage der neuen US-Zölle ist das bilaterale Handelsdefizit der USA mit dem jeweiligen nationalstaatlichen Handelspartner: Je höher das Defizit mit einem Land, desto höher der Zollsatz. Doch dieser Ansatz verkennt zentrale wirtschaftliche Zusammenhänge: Handelsbilanzdefizite resultieren nicht zwangsläufig aus unfairen Bedingungen und Praktiken, sondern oft aus Spezialisierung und komparativen Vorteilen. Daraus ergeben sich bilaterale Handelsüberschüsse und -defizite, die im globalen Kontext wieder ausgeglichen sein können.
Zusätzlich befördert eine erratische und instabile Handelspolitik einen möglichen Vertrauensverlust in den US-Dollar als globale Leit- und Reservewährung – eine zentrale Säule der US-Wirtschaftsmacht.
Folge: Die neuen US-Zollmaßnahmen verteuern Importe, schwächen die Kaufkraft amerikanischer Konsument*innen, behindern Investitionen und gefährden die wirtschaftliche Effizienz.
Zölle können keine strukturellen Probleme lösen. Statt Handelsdefizit zu senken, verlagern Zölle lediglich Handelsströme mit negativen Folgen für Wachstum und Wohlstand.
Den gesamten Artikel in DiePresse können Sie hier nachlesen.